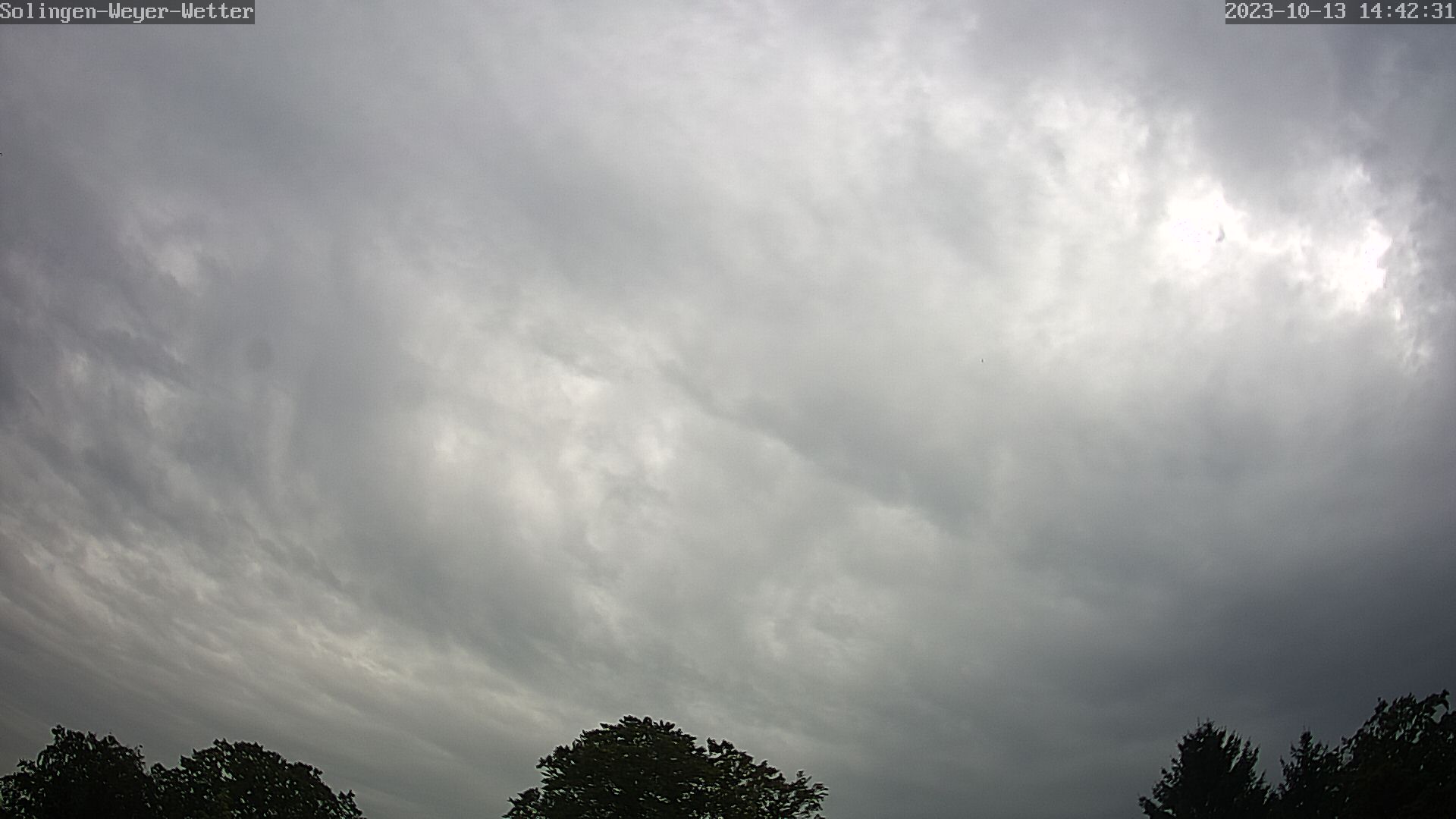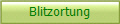

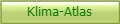

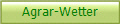





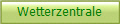

 |
|
Erstellt
am 06.09.2016 um 20:00 Uhr
Nachdem unser Wetterfreund Michael Schierbaum aus Düren sich im vergangenen Jahr die
Metegroup-Station in Breisach angesehen hatte, besuchte er in dem letzten Urlaub im August 2016 in
Wiesenburg in der Mark Brandenburg eine automatische Wetterstation des Deutschen
Wetterdienstes. Er fotografierte die Geräte durch den Zaun der eingefriedeten
Anlage. Geräte wie diese dort unterschieden sich doch nicht nur in der Größe
auch von hochwertigen Wetterstationen, wie sie von ambitionierten
"Hobby-Meteorologen" eingesetzt werden.
 |

Meteogroup-Wetterstation
Breisach BW |


Bild oben und rechts
DWD-Wetterstation Wiesenburg
Mark Brandenburg |

 |
So ergab sich doch dazu
eine ganze Reihe von Fragen, die ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes
unserem Wetterfreund Michael Schierbaum bereitwillig mit Bild und Text
beantwortete.
Der Deutsche Wetterdienst gab freundlicherweise die Genehmigung
für die Veröffentlichung der Bilder und Texte.
Liebe "Wetterfreunde",
hier seht Ihr die sehr ausführlichen Infos zu Lasermessungen der Wetterstation in Wiesenburg/Mark, die ich Euch nicht vorenthalten möchte. Denn ich bin mir sicher, dass Ihr hier viel Neues erfahrt. Ich hatte diese Station des DWD im Urlaub zufällig gesehen und mich gewundert, dass dort mit Laserstrahlungen gemessen wurde. Der DWD hatte umgehend auf meine Anfrage reagiert, was ich so nicht erwartet hatte. Über die Startseite des DWDs kann man auch eine Unzahl von Infos (Zahlen) zum Wetter in Deutschland erhalten.
Eine gute Zeit wünscht
Michael Schierbaum
Herr Rudersdorf vom Deutschen
Wetterdienst beantwortete die Anfrage:
Sehr geehrter Herr Schierbaum,
anbei die gewünschten Erklärungen zu den einzelnen Sensoren auf Ihren Fotos.
Beim Sichtweitensensor finden keine Laserstrahlen Verwendung, bei den anderen dreien schon.
|
Sichtweitensensor DF20+
Der DF20 benutzt das mit 20 Hz modulierte Licht einer weißen Halogenlampe (Wellenlänge 350 – 900
nm) und misst den Lichtanteil, der aus dem Streuvolumen von etwa 10 l Größe unter einem Winkel
von 20° bis 50° in den Empfänger gestreut wird. Je größer der in den Empfänger gestreute Anteil ist,
desto geringer ist die Sichtweite (bei unbegrenzter Sicht würde kein Licht aus dem Messvolumen
gestreut, also kein Licht auf den Empfänger fallen).
Die Oberflächen der DF20-Sensorköpfe werden temperaturabhängig beheizt, um den Ansatz von
Schnee und Eis zu verhindern. Die schräg nach unten gerichteten Sende- und Empfangsköpfe vermindern
die Schmutzanlagerung auf der Optik, die optischen Elemente (z.B. Linsen) von Sender und
Empfänger sind beheizt, um Kondensationen zu verhindern. Der Verschmutzungsgrad der Optik wird
vom Sensor selbst ermittelt und – in gewissen Grenzen – bei der Messung automatisch korrigiert.
Kann die Verschmutzung nicht mehr korrigiert werden, wird im Telegramm ein Alarmstatus erzeugt
und die MOR-Messung als ungültig gekennzeichnet.
| |

Quelle: DWD |
|
Schneehöhensensor
Der Schneehöhensensor SHM 30 (Jenoptik)
bestimmt die Gesamtschneehöhe innerhalb von Sekunden mittels Punktmessung auf
einem Schneebrett (GFK, grau, 50 x 50 cm). Er basiert auf einem
optoelektronischen Laser-Distanzsensor (Laserklasse 2). Das optische
Messverfahren ist unabhängig von Temperaturschwankungen. Temporäre
Beeinträchtigungen des Messvorgangs, zum Beispiel durch Niederschlag, werden
durch die Betriebsart kompensiert. Die Höhe des Sensors beträgt etwa 2,5 m über
Grund | |

Quelle: DWD |
|
Laser-Niederschlags-Monitor
Der
Laser-Niederschlags-Monitor
(LNM) dient der Bestimmung der aktuellen Niederschlagsart als
Ersatz für visuelle Beobachtungen an unbesetzten Stationen. Mittels einer
laser-optischen Strahlquelle
(Laserdiode und Optik) wird ein paralleles Lichtband (unsichtbares
Infrarotlicht, 780nm) erzeugt. Auf
der Empfängerseite sitzt eine Photodiode mit einer Linse, um die optische
Leistung durch Umwandlung
in ein elektrisches Signal zu messen. Fällt ein Niederschlagspartikel durch das
Lichtband (Messfläche
~46cm²), wird das Empfangssignal abgeschwächt. Aus der Amplitude der
Abschwächung wird der Durchmesser des Partikels berechnet. Außerdem wird aus der Dauer des Abschwächungssignals die Fallgeschwindigkeit des Partikels ermittelt. Die gemessenen Werte werden mit einem digitalen Signalprozessor verarbeitet und auf Plausibilität (z.B. Randtreffer) überprüft.
Berechnet werden Niederschlagsintensität, -menge, -art (Nieselregen, Regen,
Schnee, Graupel,
Hagel sowie Mischniederschläge) und das Partikelspektrum (Verteilung der
Partikel auf das
Größenspektrum). Die Niederschlagsart wird aus dem statistischen Verhältnis
aller Partikel bezüglich
Durchmesser und Geschwindigkeit bestimmt.
Zusätzlich wird mit einem an der Unterseite des Geräts montierten
Temperaturfühler die
Lufttemperatur zur Verbesserung der Erkennung verwendet: Bei Temperaturen
oberhalb +9°C werden
die Niederschläge automatisch als flüssig (Ausnahme: Graupel und Hagel) und
unterhalb von - 4°C
als fest angenommen. Im Temperaturbereich dazwischen können alle Formen des
Niederschlags
vorkommen. | |

Quelle: DWD |
|
Laserceilometer
Der Laser-Wolkenhöhenmesser arbeitet nach der Laufzeitmethode. Das Ceilometer
ist ein Wolkenhöhenmesser mit großem Messbereich, der nach dem LIDAR-Prinzip arbeitet (für Light Detection
And Ranging). Diese Sensoren erfassen einen Messbereich von 5 m bis 13000 m, neue
Sensoren auch bis 15000 m. Sie werden auf Flughäfen und an automatischen Wetterstationen
eingesetzt.Von einem Laser-Dioden-Stack werden kurze Lichtimpulse vertikal in die
Atmosphäre gesandt. Das Licht wird an den kleinen Wassertröpfchen der Wolken reflektiert, und ein Teil
des zurück gestreuten Lichts gelangt in den Empfänger, der neben dem Sender angebracht ist. Die Zeit,
die das Licht für den Weg vom Sender zur Wolke und zurück in den Empfänger benötigt, wird gemessen und
die Wolkenuntergrenze berechnet. Es können bis zu drei Wolkenschichten erkannt werden. Neben den
Messdaten zur Wolkenhöhe können auch Messwerte zur vertikalen Sichtweite gewonnen werden.
Jeweils nach Abschluss der Messroutine wird die Auswertung der zurück gestreuten Signale
und die Bestimmung der Wolkenhöhe durch den Mikroprozessor durchgeführt. Bei den im DWD
eingesetzten Sensoren sind Sender und Empfänger zusammen in einem Gehäuse untergebracht. Das
doppelwandige Gehäuse ist mit einer thermostatgesteuerten Heizung ausgestattet und erlaubt mit
ihr den Einsatz unter verschiedensten klimatischen Bedingungen. Im DWD werden zwei verschiedene
Laserceilometer eingesetzt. Das sind der LD 40 von Vaisala und der CHM 15k von der Firma
Jenoptik. Beide Sensoren haben nahezu das gleiche Funktionsprinzip |
|

Quelle:DWD |
Zur
Startseite
|